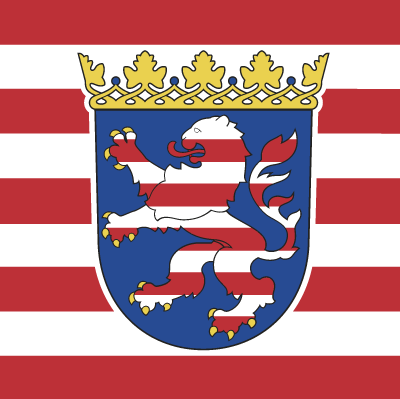Wie Handschreiben das Gehirn trainiert
Handschreiben ist eine uralte Kulturtechnik, die ihren Ursprung vor über 5.000 Jahren in Mesopotamien und Ägypten hatte. Menschen begannen Gedanken, Fakten oder Verträge mit Schriftzeichen festzuhalten, indem sie mit einem Stift Symbole in Ton ritzten oder mit Schilfrohr Zeichen auf Papyrus malten. Über Tausende von Jahren hinweg war die Schriftsprachkultur durch Handschreiben geprägt. In den letzten Jahren hat sich die Art des Schreibens jedoch massiv gewandelt. Digitale Schreibgeräte wie Computer, Tablets oder Mobiltelefone ersetzen zunehmend die Handschrift. Diese veränderten Schreibgewohnheiten können sich auf die Gehirnfunktion und damit auf die geistigen Fähigkeiten des Menschen auswirken. Es zeigt sich jetzt schon, dass häufiges Tippen auf einer Tastatur anstelle von Handschreiben mit einer verringerten Feinmotorik einhergeht. Obwohl es keine eindeutige Evidenz für den Vorteil des Tippens auf digitalen Geräten für den Schriftspracherwerb gibt, wird Handschreiben immer wieder als Kulturtechnik aus vergangenen Jahrhunderten belächelt, die im Unterricht des digitalen Zeitalters keinen Platz mehr hat. Gibt es wissenschaftlich fundierte Gründe für das Beibehalten der Handschrift im Schulunterricht, die über Sentimentalität hinausgehen?
Bei der Beurteilung von Vor- und Nachteilen von Schreibgeräten für den schulischen Unterricht sollten allerdings nicht nur die höheren Anforderungen an die Feinmotorik beim Schreiben mit Papier und Stift im Vergleich zum Tippen auf einer Computertastatur betrachtet werden. Genauso wichtig, wenn nicht gar wichtiger, ist die Qualität der kognitiven Prozesse, die beim Schriftspracherwerb oder auch beim flüssigen Schreiben durch ein Schreibgerät gleichsam beiläufig ausgelöst werden.

Prof. Dr. Markus Kiefer
Leiter der Sektion für Kognitive Elektrophysiologie an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Universität Ulm
Hier ist zu beachten, dass beim Handschreiben jeder einzelne Buchstabe durch eine spezifische Schreibbewegung geformt werden muss. Das motorische Programm beim Schreiben greift somit die Gestalt der Buchstaben auf. Das hat zur Konsequenz, dass die durch das Handschreiben angelegte motorische Gedächtnisspur die visuelle Gedächtnisspur zur Buchstabenform unterstützen kann.
Zahlreiche Studien haben gezeigt, dass nicht nur visuelle, sondern auch motorische Bereiche des Gehirns aktiv werden, wenn Erwachsene, die auf traditionelle Weise Handschreiben gelernt haben, Buchstaben betrachten. Die motorische Aktivierung blieb aber aus, wenn beim Lernen die unbekannten Buchstaben auf einer Tastatur getippt werden. In ähnlicher Weise wurde bei fünfjährigen Kindern nur dann eine Aktivierung in motorischen Gehirnbereichen beim Betrachten von Buchstaben festgestellt, wenn sie diese zuvor per Handschreiben gelernt hatten.
Viele Befunde legen weiterhin nahe, dass das Erlernen der Schriftsprache per Handschreiben im Vergleich zum Tippen das Buchstabenerkennen, Wortschreiben und -lesen verbessert. Wir führten eine umfangreiche Studie mit 147 Kindergartenkindern durch. In der Studie wurden Kindergartenkinder und keine Schulkinder als Probanden gewählt, da diese noch nicht in einem Unterricht Lesen und Schreiben gelernt haben. Eine Trainingsgruppe schrieb die Buchstaben mit Stift und Papier, eine zweite Gruppe tippte die Buchstaben auf der virtuellen Tastatur eines Tabletcomputers und eine dritte Trainingsgruppe lernte die Buchstaben mit diesem Gerät zu schreiben. In der Gesamtschau der Ergebnisse waren Stift und Papier das Schreibwerkzeug mit den meisten Vorteilen und den geringsten Nachteilen. Schreiben mit Stift und Papier förderte das Erkennen von Buchstaben sowie nicht-sprachliche, visuell-räumliche Fähigkeiten, da sich die Kinder beim Handschreiben die räumliche Anordnung der Striche bei einem Buchstaben präzise merken müssen. Dies war beim Tippen auf einer Tastatur nicht der Fall. Das Schreiben mit dem Stylus auf dem Touchscreen eines Tablets wies im Vergleich zu Stift und Papier sowie Tastatur das ungünstigste Leistungsprofil auf.
Handschreiben mit Stift und Papier ist somit keine veraltete Kulturtechnik aus den letzten Jahrtausenden, sondern hat eine kognitionswissenschaftlich fundierte Berechtigung als Schreibmethode im schulischen Unterricht. Im Vergleich zu digitalen Schreibgeräten weist Handschreiben mit Stift und Papier sowohl im Elementarbereich als auch im weiteren Verlauf des Bildungsprozesses einige nennenswerte Vorteile auf. Dies zeigt, dass der Einsatz digitaler Geräte im Schulunterricht keinen Selbstzweck darstellt, sondern ein pädagogisches Konzept erfordert, das einen Mehrwert gewährleistet.
Prof. Dr. Markus Kiefer
Leiter der Sektion für Kognitive Elektrophysiologie an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Universität Ulm